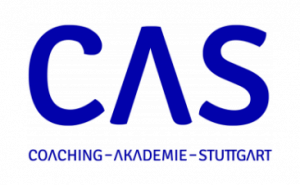Systemisches Coaching: Definition, Ziele & Co.
Systemisches Coaching ist ein prozessorientiertes Beratungsformat, das Klient*innen bei beruflichen und privaten Fragen unterstützt. Es betrachtet Menschen als Teil verschiedener sozialer Systeme und befasst sich mit den Wechselwirkungen innerhalb dieser Systeme sowie dem Einfluss individueller Veränderungen auf sie.
Möchten Sie gerne selbst Einblicke erhalten? In Folge haben wir alles zusammengefasst, was Sie über systemisches Coaching wissen müssen – Anwendungsfelder, verschiedene Modelle und wie Sie es erlernen können.
Was ist systemisches Coaching? Definition
Zentrale Merkmale des systemischen Coachings
Für wen ist eine Ausbildung zum systemischen Coach sinnvoll?
Wen können Sie als systemischer Coach unterstützen?
Wie ist die Herangehensweise? Ansätze, Methoden und Modelle
Wie wird man systemischer Coach?
Was ist systemisches Coaching? Definition
Systemisches Coaching ist ein reflexions- und lösungsorientierter Begleitprozess, bei dem Menschen darin unterstützt werden, ihre Anliegen im Kontext ihrer relevanten sozialen Systeme zu verstehen und zu bearbeiten. Im Zentrum steht dabei nicht das „Problem“ an sich, sondern die Beziehungsmuster, Kommunikationsstrukturen und Verhaltensdynamiken, in die das Anliegen eingebettet ist.
Das systemische Coaching folgt keinem linearen Ursache-Wirkungs-Denken. Es basiert vielmehr auf einer konstruktivistischen Haltung: Wirklichkeit wird als subjektiv erlebt, Sinn entsteht in Interaktion und jede Veränderung hat Auswirkungen auf das gesamte System.
Zentrale Merkmale des systemischen Coachings
Am besten lässt sich die Frage “Was ist systemisches Coaching?” beantworten, indem man seine zentralen Merkmale in Betracht zieht. Diese sind:
- Kontextsensibilität: Klient*innen werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil sozialer Systeme (z. B. Familie, Team, Organisation).
- Ressourcenorientierung: Statt auf Defizite zu fokussieren, wird gezielt nach vorhandenen Kompetenzen, Erfahrungen und Stärken gesucht.
- Zirkularität: Ursachen werden nicht linear gedacht („Weil X, passiert Y“), sondern als Wechselwirkungen („Wenn X sich so verhält, reagiert Y so – was wiederum X beeinflusst“).
- Selbststeuerung: Systemisches Coaching fördert die Selbstorganisation – Coaches sind also keine reinen Ratgeber*innen, sondern eher Prozessbegleiter*innen.
Gerade diese Haltungsmerkmale unterscheiden systemisches Coaching grundlegend von direktiven Methoden: Es geht nicht darum. „Tipps zu geben“, sondern um die Stärkung der Selbstwirksamkeit durch einen geschützten Reflexionsraum.
Für wen ist eine Ausbildung zum systemischen Coach sinnvoll?
Systemisches Coaching ist kein starres Instrument, sondern ein anpassungsfähiges, methodenreiches Verfahren, das in verschiedenen Lebens- und Berufslagen wirksam werden kann. Typische Einsatzbereiche reichen deshalb von Führungskräfteentwicklung über berufliche Neuorientierung bis hin zur persönlichen Krisenbewältigung.
In der Praxis zeigen sich 4 zentrale Anwendungsfelder:
- Führung & Management: Führungspersonen nutzen systemisches Coaching, um Rollen zu klären, Verantwortungsfragen zu reflektieren oder in Konfliktsituationen einen systemischen Blick zu entwickeln.
- Beratung und Coaching-Praxis: Viele angehende Coaches, Therapeut*innen oder Supervisor*innen erweitern durch eine systemische Ausbildung ihr Methodenrepertoire. Sie lernen, wie sie mit Klient*innen arbeiten, Hypothesen bilden und durch gezielte Fragen und Moderationstechniken Veränderung anregen können.
- Personalentwicklung und HR: In der Organisationsentwicklung setzen HR-Verantwortliche systemisches Coaching ein, um Veränderungsprozesse partizipativer zu gestalten, Mitarbeitende in ihrer Entwicklung zu fördern und Kulturtransformationen zu begleiten.
- Persönliche Themen und Lebensfragen: Auch außerhalb beruflicher Kontexte unterstützt systemisches Coaching Menschen bei Übergängen, dem Lösen von inneren Blockaden, Beziehungskonflikten oder der Sinnsuche. Gerade hier entfaltet der Ansatz seine Wirkung durch Offenheit, Wertschätzung und Kontextverstehen.
Systemisches Coaching wirkt besonders dann, wenn es darum geht, über das Offensichtliche hinauszudenken: Es hilft Klient*innen, eingefahrene Muster zu erkennen, neue Optionen zu entdecken – und in einem geschützten Rahmen neue Wege zu erproben.
Wen können Sie als systemischer Coach unterstützen?
Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen – und häufig noch nicht vollkommen konkreten – Anliegen ins Coaching. Doch was systemisches Coaching besonders macht, ist seine Fähigkeit, auch in nicht klar umrissenen Situationen wirksam zu werden.
So begegnen Coaches Klient*innentypen, die unterschiedliche Herangehensweisen erfordern, wie Nevenka Miljkovic, eine Trainerin der Coaching Akademie Stuttgart, Ihnen in unserem Video erklärt:
- „Die Kunden“: Klient*innen mit klaren Zielen und Erwartungen.
- „Die sich Beklagenden“: Personen, die Probleme benennen, aber wenig bis keine Eigenverantwortung sehen.
- „Die Geschickten“: Klient*innen, die auf Initiative Dritter zum Coaching kommen.
- „Die Supervisoren“: Personen, die Unterstützung für andere geben möchten.
Ein professioneller Coach erkennt diese Typen und passt den Coachingprozess entsprechend an, um eff ektive Unterstützung zu bieten.
Wie ist die Herangehensweise? Ansätze, Methoden und Modelle
Der größte Nutzen von Coaching ist die nachhaltige Selbststeuerung. Klient*innen nehmen sich durch systemisches Coaching selbst nicht länger als Opfer äußerer Umstände wahr, sondern erkennen, wie sie – durch veränderte Sichtweisen und Handlungen – ihr System beeinflussen können.
Wie können Sie als systemischer Coach Klient*innen dabei begleiten, ihre konkreten Ziele zu definieren und Wege dorthin zu finden? Je nach Anliegen können Sie gezielt spezialisierte Methoden einsetzen, die Orientierung geben und die Prozessführung strukturieren. Einige zentrale Ansätze und Modelle, auf die sie zurückgreifen können, werden in Folge kurz erklärt.
1. Systemisch ausgelegte Fragetechniken
Systemisches Coaching arbeitet nicht mit Ratschlägen, sondern mit speziellen Fragen – z. B. offenen, zirkulären, hypothetischen oder paradoxen Fragen. Diese helfen dabei, Beziehungen sichtbar zu machen, blinde Flecken zu erkennen und neue Perspektiven zu eröffnen.
Die Fragen öffnen den Raum für neue Bedeutungszuschreibungen, unterbrechen automatische Denkmuster und erlauben es Klient*innen, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen – nicht als „Problemträger*in“, sondern als aktiver Teil eines Systems mit Einflussmöglichkeiten.
Anstatt einfache „Ja oder Nein“-Fragen zu stellen, arbeiten systemische Coaches z. B. mit „Wozu“, „Was wäre, wenn“ oder „Wer würde das anders sehen?“ – um Muster zu unterbrechen und neue Möglichkeitsräume zu erschließen.
2. Personenzentrierte Gesprächsführung
Auch die personenzentrische Gesprächsführung, eine von Carl Rogers entwickelte Haltung, prägt das systemische Coaching: Empathie, Kongruenz und bedingungsfreie Wertschätzung schaffen einen sicheren Raum, in dem Klient*innen eigene Gedanken aussprechen, neu sortieren und Vertrauen in ihre Lösungsfähigkeit entwickeln können. Diese Gesprächsführung ist nicht neutral – sie ist den Klient*innen aktiv zugewandt und unterstützend.
3. Transaktionsanalyse (TA)
Die Transaktionsanalyse (TA) ist ein psychologisches Modell, das von Eric Berne auf Basis der Psychoanalyse entwickelt wurde. Sie analysiert, aus welchem Ich-Zustand („Eltern-Ich“, „Erwachsenen-Ich“ oder „Kind-Ich“) heraus eine Person spricht. Wenn beide Gesprächspartner in den gleichen Ich-Zuständen interagieren, kann die Kommunikation reibungslos ablaufen.
Elemente der Transaktionsanalyse bieten hilfreiche Modelle zur Analyse von Kommunikationsmustern – vor allem in konflikthaften Beziehungen. Sie können dabei helfen, automatische Reaktionsmuster zu erkennen und bewusste Handlungsoptionen zu entwickeln.
4. Zürcher Ressourcenmodell (ZRM)
Das ZRM ist ein evidenzbasiertes Selbstmanagement-Tool, das dabei hilft, Handlungspotenziale zu erkennen und zu aktivieren. Es eignet sich somit z. B. besonders gut, um unklare Ziele zu klären, motivierende Haltungen aufzubauen und Ressourcen gezielt zu aktivieren.
5. Neurolinguistisches Programmieren (NLP)
Aus dem NLP werden vor allem Visualisierungstechniken, Sprachmuster und Reframing-Strategien ins Coaching übernommen. Richtig angewendet – und kritisch reflektiert – können sie helfen, hinderliche Deutungen aufzulösen und neue Bedeutungsrahmen zu etablieren.
6. Aufstellungsarbeit
Systemische Aufstellungen machen Beziehungsdynamiken, Rollen und verdeckte Spannungen sichtbar – sei es im Team, im Familiensystem oder im inneren Erleben der Klient*innen. Dabei wird ein Anliegen mit Symbolen oder Figuren räumlich dargestellt, sodass implizite Muster greifbar und veränderbar werden.
Typische Formate von Aufstellungen im systemischen Coaching sind:
- Strukturaufstellungen mit Bodenankern oder Symbolen (z. B. Figuren, Karten, Gegenstände)
- Teamaufstellungen zur Klärung organisationaler Spannungen
- Innere Aufstellungen für innere Anteile oder konflikthafte „Stimmen“
- Organigramm-Aufstellungen zur Reflexion von Führung, Macht und Kommunikation
Ziel ist dabei nicht „die Wahrheit“, sondern ein Perspektivwechsel, der Reflexion und Entwicklung ermöglicht. Wichtig dabei: professionelle Auftragsklärung, behutsames methodisches Vorgehen und eine strukturierte Nachbereitung.
7. Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
Die von Marshall Rosenberg entwickelte Methode stärkt die Fähigkeit, Bedürfnisse klar zu kommunizieren, ohne dabei zu verletzen. In Coachings kommt GFK oft bei inneren oder äußeren Konflikten zum Einsatz – etwa wenn es darum geht, zwischen eigenen Erwartungen, Gefühlen und Strategien zu unterscheiden.
8. Das Innere Team
Dieses Modell von Friedemann Schulz von Thun hilft, innere Ambivalenzen sichtbar zu machen: Statt „Ich bin unentschlossen“ zu sagen, wird deutlich, dass verschiedene innere Stimmen miteinander ringen – etwa „die Pflichtbewusste“, „der Rebell“, „die Vorsichtige“. Durch Visualisierung und Rollendialoge wird daraus ein sortierter Prozess innerer Klärung. Ziel ist es, die inneren Stimmen zu verstehen und in Einklang zu bringen.
Wie wird man systemischer Coach?
Grundsätzlich benötigen Sie das richtige Mindset, um mit dem Coaching zu beginnen. Denn was ist ein systemischer Coach, wenn nicht jemand, der oder die anderen Menschen helfen möchte? Doch damit alleine ist es nicht getan, denn systemisches Coaching erfordert weit mehr als Kommunikationsgeschick oder ein gutes Gespür für Menschen.
Es ist ein anspruchsvolles Handwerk, das fundiertes Wissen, methodische Vielfalt und eine reflektierte Haltung vereint. Wer professionell coachen möchte, sollte sich auf einen intensiven Lern- und Entwicklungsprozess einlassen und den Weg einer zertifizierten Coaching-Ausbildung einschlagen.